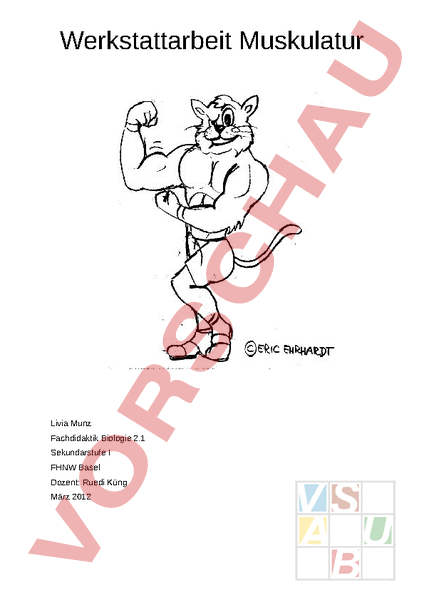Arbeitsblatt: Muskulatur
Material-Details
Postenarbeit zum Thema Muskulatur - Aufbau, Funktion und Muskelarbeit. Die Lösungen sind im Dokument enthalten.
Biologie
Anatomie / Physiologie
6. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
97350
1638
65
14.04.2012
Autor/in
Topo (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Werkstattarbeit Muskulatur Livia Munz Fachdidaktik Biologie 2.1 Sekundarstufe FHNW Basel Dozent: Ruedi Küng März 2012 Werkstattarbeit zur Muskulatur Informationen: Bau der Skelettmuskeln: Die meisten Skelettmuskeln haben Spindelform. Andere Formen finden wir bei den flächenartig verbreiterten und bandförmigen Muskeln des Rumpfes und bei den aus mehreren Spindeln zusammengesetzten Muskeln. Jeder Muskel besteht aus einer grossen Anzahl von Muskelsträngen, jeder Strang aus mehreren Faserbündeln, jedes Bündel aus vielen Fasern. Jede Muskelfaser enthält wiederum eine Vielzahl feiner Fäden, die Fibrillen. Die Fasern der Skelettmuskeln sind zu Bündeln zusammengefasst, die mit Bindegewebehüllen voneinander getrennt sind. Bei Kontraktionen können auch nur einzelne Faserbündel zusammengezogen werden. Die rote Farbe eines Skelettmuskels stammt nicht vom Blut, sondern vom Muskelfarbstoff Myoglobin. Myoglobin speichert Sauerstoff, der für etwa 10 Sekunden strenge Muskelarbeit ausreicht. Arbeit der Skelettmuskeln: Muskeln kontrahieren sich, dabei verkürzen und verdicken sie sich. Die gespeicherte chemische Energie, im Wesentlichen Glukose, wird in mechanische Arbeit umgewandelt und die Muskeln entfalten ihre Kraft. In ihre Ausgangslage können sie nur passiv zurückkehren, durch Dehnung, die entweder von einem Gegenspieler ausgeht oder durch die Schwerkraft bewirkt wird. Einen angewinkelten Arm zum Beispiel kann man einfach fallenlassen, ohne dass der Trizeps auf der Rückseite des Oberarmes den Bizeps dehnt. Alle Muskeln, egal ob quer gestreifte Skelettmuskulatur, glatte Eingeweidemuskeln oder Herzmuskelzellen, arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Lernziele: SuS wissen, wie die Skelettmuskulatur aufgebaut ist. SuS können einige Muskeln unseres Körpers benennen. SuS kennen das Gegenspielerprinzip. Aufbau der Postenarbeit: Posten 21: Benennung der Skelettmuskulatur Posten 22: Aufbau der Skelettmuskulatur Posten 23: Wie funktionieren Muskeln? Posten 24: Die Muskulatur spüren Posten 25: Sehnen Material: Kopien zur Postenarbeit. Schulbücher, Quellen: Menschenkunde: für die Sekundarstufe I, Forster Jakob, Verlag SekZH, 2006, S. 55 – 137. Urknall 5/6: Aegerter Klaus, Klett und Balmer Verlag Zug, 2009, Schulbuch S. 9/120 – 9/125, Lehrerhandbuch S. 249 – 259. Biologie 1 GN: Bayerischer Schulbuch Verlag GmbH,1999, Schulbuch S. 21 – 30, Lehrerhandbuch S. 17 – 28. 2 3 Laufblatt zur Werkstattarbeit: Muskulatur Nummer 4 Postenname Zeit Wie viele? Bemerkungen 21 Benennung der Skelettmuskulatur 15 min 22 Aufbau der Skelettmuskulatur 15 min 23 Wie funktionieren Muskeln? 20 min Versuch am eigenen Körper 24 Die Muskulatur spüren 30 min Versuch am eigenen Körper 25 Sehnen 20 min Versuch am eigenen Körper Auch als Hausaufgabe möglich Gelöst Posten 21: Benennung der Skelettmuskulatur Die Skelettmuskulatur setzt sich aus mehr als 500 einzelnen Muskeln zusammen, die durch die Kraft unseres Willens bewegt werden können. Dieses Arbeitsblatt zeigt nur einige wenige davon auf. Beschrifte dieses Arbeitsblatt mit Hilfe des Schulbuchs Urknall 5/6 Seite 9/121. 5 Male die beschriftete Muskulatur mit unterschiedlichen Farben aus. 6 Posten 21: Lösung Kaumuskel Nackenmuskulatur Armheber grosser Brustmuskel Beuger Strecker Bauchmuskeln Oberschenkelmuskulatur Schienbeinmuskel Wadenmuskel 7 Posten 22: Aufbau der Skelettmuskulatur Im Grunde sind Muskeln nichts anderes als das, was wir auch als Fleisch bezeichnen und von den Tieren essen. An gekochtem oder gebratenem Fleisch kann man sehr leicht erkennen, dass es aus lauter Fasern besteht. Skelettmuskeln wie der Armstrecker und Armbeuger sind alle gleich aufgebaut. Die Sehne verbindet den Muskel mit dem Knochen. Der mit der Sehne verbundene Muskel besteht aus vielen Muskelfaserbündeln. Jedes Muskelfaserbündel besteht aus tausenden von Muskelfasern. Diese Muskelfasern sind durch Bindegewebshüllen voneinander getrennt. Die Fasern bestehen wiederum aus einer Vielzahl von „Fäden, den sogenannten Fibrillen. Innerhalb dieser Fibrillen findet die Muskelbewegung statt. 8 Posten 22: Arbeitsblatt Beschrifte mit Hilfe des Textes die Abbildung und klebe sie danach in dein Biologieheft ein. Der Titel lautet „Aufbau der Skelettmuskulatur. 9 Posten 22: Lösung 10 11 Posten 23: Wie funktionieren Muskeln? Ein Muskel, der sich zusammengezogen hat, kann sich nicht mehr selbstständig strecken. Wenn der Muskel erschlafft ist, kann er durch einen anderen Muskel, einen Gegenspieler, wieder gestreckt werden. Damit wir den Arm beugen und strecken können, brauchen wir also zwei Muskeln, die einander entgegenwirken. Wenn sich der eine zusammenzieht, wird der andere gestreckt. Solche Muskeln nennt man Gegenspieler. Damit wir den Arm beugen können, muss sich der Armbeugermuskel (Bizeps) zusammenziehen. Dabei wird der Armstreckermuskel (Trizeps) gedehnt. Damit wir den Arm strecken können, muss sich der Armstreckermuskel (Trizeps) zusammenziehen. Dabei wird der Armbeugermuskel (Bizeps) gedehnt. 12 Partnerarbeit Wo an eurem Körper könnt ihr noch solche Gegenspielerprinzipe entdecken? Schreibt mindestens drei solche Körperstellen in euer Biologieheft. Macht eine Zeichnung von den drei Körperstellen und beschreibt, welcher Muskel der Beuger, beziehungsweise der Strecker ist und wann der entsprechende Muskel zusammengezogen, beziehungsweise gestreckt ist. Nehmt danach das Arbeitsblatt aus der Mappe und vervollständigt den Text. Posten 23: Arbeitsblatt Schneide das Arbeitsblatt aus und klebe es in dein Biologieheft ein. Schreibe den Titel „Wie funktionieren Muskeln? darüber. Wenn ein Muskel zieht er sich zusammen. Der Muskel kann sich dann nur mit Hilfe eines wieder strecken. Damit wir den Arm also strecken oder beugen können, benötigen wir Muskeln, den (Bizeps) und den (Trizeps). 13 Posten 23: Lösung Schneide das Arbeitsblatt aus und klebe es in dein Biologieheft ein. Schreibe den Titel „Wie funktionieren Muskeln? darüber. Wenn ein Muskel erschlafft zieht er sich zusammen. Der Muskel kann sich dann nur mit Hilfe eines Gegenspielers wieder strecken. Damit wir den Arm also strecken oder beugen können, benötigen wir zwei Muskeln, den Beuger (Bizeps) und den Strecker (Trizeps). 14 Posten 24: Die Muskulatur spüren Führe bei folgenden Versuchen kurze Protokolle. Beschreibe also was du gemacht hast und was du empfunden hast. Führe diese Versuche, wenn möglich, zu zweit durch, damit ihr eure Empfindungen besprechen könnt. 1. Nimm ein grösseres Buch in die Hand und strecke den Arm seitwärts aus und warte 2 Minuten. Beschreibe deine Empfindungen. 2. Stehe auf und strecke ein Bein waagrecht nach vorn. Halte es eine Zeit so. Beschreibe deine Empfindungen. 3. Umfasse mit der linken Hand den rechten Oberarm. Beuge und strecke nun den rechten Arm. Was stellst du fest? 4. Taste entspannte und angespannte Muskeln am Arm und Bein ab. Was stellst du fest? 5. Stellt euch vor, ihr wärt an einem Wettkampf für einen 100 Meter Lauf. Der erste Schüler geht in Startposition, als wolle er gerade losrennen. Der andere Schüler tastet das in Position gestellte Bein ab. Welcher Muskel ist angespannt, welcher Muskel entspannt? Könnt ihr auch etwas am Oberschenkel fühlen? Nun wechselt ihr. Notiert euch, was ihr festgestellt habt. 15 Posten 24: Die Muskulatur spüren Führe bei folgenden Versuchen kurze Protokolle. Beschreibe also was du gemacht hast und was du empfunden hast. Führe diese Versuche, wenn möglich, zu zweit durch, damit ihr eure Empfindungen besprechen könnt. 1. Nimm ein grösseres Buch in die Hand und strecke den Arm seitwärts aus und warte 2 Minuten. Beschreibe deine Empfindungen. Die Arm- und Schultermuskeln spannen sich an und werden ein wenig dicker. Dann beginnen sie zu zittern und werden warm. Schliesslich ermüdet der Arm. 2. Stehe auf und strecke ein Bein waagrecht nach vorn. Halte es eine Zeit so. Beschreibe deine Empfindungen. Wir haben Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Bestimmte Muskeln des angehobenen Beines und des Standbeines spannen sich an und ermüden mit der Zeit. 3. Umfasse mit der linken Hand den rechten Oberarm. Beuge und strecke nun den rechten Arm. Was stellst du fest? Wenn der Arm gebeugt wird, wird der Beuger (Muskel am äusseren Oberarm) dicker und der Strecker dünner. Beim Strecken wird der Beuger dünner und der Strecker nur ganz leicht dicker. 4. Taste entspannte und angespannte Muskeln am Arm und Bein ab. Was stellst du fest? Angespannte Muskeln sind dicker als entspannte Muskeln. Die Muskeln können also ihre Form verändern. 5. Stellt euch vor, ihr wärt an einem Wettkampf für einen 100 Meter Lauf. Der erste Schüler geht in Startposition, als wolle er gerade losrennen. Der andere Schüler tastet das in Position gestellte Bein ab. Welcher Muskel ist angespannt, welcher Muskel entspannt? Könnt ihr auch etwas am Oberschenkel fühlen? Nun wechselt ihr. Notiert euch, was ihr festgestellt habt. Der Wadenmuskel ist angespannt und verdickt. Die Muskulatur am Schienbein ist kaum spürbar. Der äussere Muskel am Oberschenkel ist angespannt. Wenn das Bein gestreckt wird, entspannt sich die Wadenmuskulatur und die Schienbeinmuskulatur ist angespannt. Genauso wie am Oberschenkel, wo sich der äussere Oberschenkelmuskel entspannt und der innere Oberschenkelmuskel anspannt. 16 Posten 25: Sehnen Führe bei folgenden Versuchen kurze Protokolle. Beschreibe also was du gemacht hast und was du empfunden hast. Führe diese Versuche, wenn möglich, zu zweit durch, damit ihr eure Empfindungen besprechen könnt. 1. Halte deine flache Hand dicht über den Tisch. Beuge die Finger einzeln mehrfach schnell nach unten, als ob du Klavier spielen würdest. Beobachte den Handrücken. Was stellst du fest? Notiere in dein Biologieheft. 2. Im Sitzen stellst du einen Fuss mit der ganzen Sohle auf den Fussboden. Hebe die Ferse ein wenig an und senke sie wieder. Umfasse mit beiden Händen den Oberschenkel des Beines, direkt über dem Knie. Was bewegt sich da? Kannst du diesen „Fäden folgen, sind die am ganzen Oberschenkel spürbar oder nur beim Knie? Notiere in dein Biologieheft. 3. Umfasse mit der linken Hand die Innenseite deines rechten Handgelenkes. Bewege nun die Finger deiner rechten Hand kräftig. Was kannst du spüren? Notiere in dein Biologieheft. 4. Setze dich hin und stelle deine Füsse auf den Boden. Umfasse mit einer Hand ein Bein, oberhalb des Fussgelenks. Krümme und strecke nun deine Zehen. Was stellst du fest? Vergleiche anschliessend deine Ergebnisse und Erkenntnisse mit den Lösungen. Übertrage den zusätzlichen, in den Lösungen stehenden Text in dein Heft. 17 Posten 25: Lösung Führe bei folgenden Versuchen kurze Protokolle. Beschreibe also was du gemacht hast und was du empfunden hast. Führe diese Versuche wenn möglich zu zweit durch, damit ihr eure Empfindungen besprechen könnt. 1. Man sieht, wie sich die Sehnen vom Fingergelenk Richtung Handgelenk bewegen. Die Sehnen der Finger sind mit dem Handgelenk verbunden und deshalb sehr gut sichtbar. 2. Der Oberschenkelmuskel ist durch sehr starke Sehnen mit dem Kniegelenk verbunden. Diese Sehnen sind sehr gut spürbar. Einige der unterschiedlichen Sehnen kann man zwar bis relativ weit nach hinten spüren, sie laufen aber alle früher oder später in den Oberschenkelmuskel über. 3. Die Sehnen sind nicht nur oben am Handgelenk angemacht, sondern verlaufen auch auf der Handinnenseite. Diese Sehnen sind um einiges dünner und feiner als die Sehnen am Oberschenkel. 4. Auch hier verbinden viele Sehnen der Zehenmuskulatur über das Fussgelenk hinaus die Zehenmuskulatur mit dem Schienbeinknochen. Dies sind wieder eher starke Sehnen. Übertrage folgenden Textabschnitt in dein Arbeitsheft, unterhalb deiner Versuchsprotokolle: Sehnen sind ziemlich fest und unelastisch. Sie ähneln Seilen, die den Muskel immer an beiden Enden mit einem Knochen verbinden. Teilweise hat es auch mehrere Sehnen, die den Muskeln mit unterschiedlichen Knochen verbinden. Werden Sehnen durch die Muskelkraft zu stark belastet, können sie reissen. Sehnen, die stark beansprucht sind, können sich entzünden. Dies nennt man dann Sehnenscheideentzündung. 18