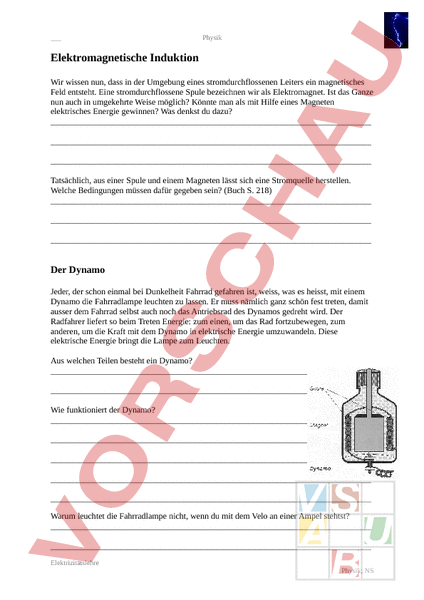Arbeitsblatt: Induktion
Material-Details
Arbeitsmaterial zur Elektromagnetischen Induktion
Physik
Elektrizität / Magnetismus
8. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
99244
1200
13
24.05.2012
Autor/in
Kein Spitzname erfasst
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
_ Physik Elektromagnetische Induktion Wir wissen nun, dass in der Umgebung eines stromdurchflossenen Leiters ein magnetisches Feld entsteht. Eine stromdurchflossene Spule bezeichnen wir als Elektromagnet. Ist das Ganze nun auch in umgekehrte Weise möglich? Könnte man als mit Hilfe eines Magneten elektrisches Energie gewinnen? Was denkst du dazu? Tatsächlich, aus einer Spule und einem Magneten lässt sich eine Stromquelle herstellen. Welche Bedingungen müssen dafür gegeben sein? (Buch S. 218) Der Dynamo Jeder, der schon einmal bei Dunkelheit Fahrrad gefahren ist, weiss, was es heisst, mit einem Dynamo die Fahrradlampe leuchten zu lassen. Er muss nämlich ganz schön fest treten, damit ausser dem Fahrrad selbst auch noch das Antriebsrad des Dynamos gedreht wird. Der Radfahrer liefert so beim Treten Energie: zum einen, um das Rad fortzubewegen, zum anderen, um die Kraft mit dem Dynamo in elektrische Energie umzuwandeln. Diese elektrische Energie bringt die Lampe zum Leuchten. Aus welchen Teilen besteht ein Dynamo? Wie funktioniert der Dynamo? Warum leuchtet die Fahrradlampe nicht, wenn du mit dem Velo an einer Ampel stehtst? Elektrizitätslehre Physik; NS Physik Was geschieht, wenn sich der Magnet an der Spule vorbeidreht? Der Generator (Buch S. 223 und 224) Die Funktionsweise des Generators beruht auf der elektromagnetischen Induktion. Die ersten Generatoren wurden im Jahre 1832 erbaut, kurz nach der Entdeckung der Induktion. Wie kam es zu dieser Entdeckung? Wie ist ein Generator aufgebaut? Wie funktioniert die Stromgewinnung beim Generator? Der Elektromotor (Buch ab S. 213) Elektrizitätslehre Physik; NS Physik Der Elektromotor dient zur Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie, mit der mechanische Arbeit verrichtet wird. Dabei wird eine Drehbewegung erzeugt, die zum Antrieb von Geräten und Anlagen verwendet wird. Elektromotoren werden als Antrieb für zahlreiche Geräte gebraucht, beispielsweise CDPlayer, Fön, Bohrmaschine und so weiter. Elektromotoren sind sehr weit verbreitet, weil sie dem Menschen diverse Alltagsarbeiten erleichtern. Der Nachteil von Elektromotoren ist, dass sie jeweils an eine Stromquelle gebunden sind, um zu funktionieren. Prinzip des Elektromotors Als einfachstes Modell eines Motors kann man sich zwei Magnete vorstellen: Einer ist drehbar und einer steht still. Da sich ungleiche Pole anziehen, wird der drehbare Magnet so weit drehen, bis sich jeweils zwei ungleiche Pole gegenüberstehen. Jetzt müsste man die Pole des einen Magnaten vertauschen, um die Drehung weiterführen zu können. Dies ist mit einem Permanentmagnet nicht möglich, mit einem Elektromagneten hingegen schon, wenn man nämlich die Pole der Batterie vertauscht. Bau und Funktion eines Elektromotors Der Elektromotor dient der Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie, mit der mechanische Arbeit verrichtet wird. Dabei wird eine Drehbewegung erzeugt, die zum Antrieb von Geräten und Anlagen verwendet wird. In der Abbildung siehst du das stark vereinfachte Modell eines funktionstüchtigen Elektromotors. Wir erkennen drei Teile: Einen unbeweglichen Teil, „Stator genannt, und einen drehbaren Teil, den „Rotor. Wichtig sind ausserdem jene Bauteile, die zur Übertragung des Stromes auf die beweglichen Teile dienen. Der Statormagnet besteht in der Abbildung aus einem permanenten Hufeisenmagnet, der Rotor aus einem Spulenmagnet. Schaltet ein 1 man den Strom ein, so wird in der Rotorspule Magnetfeld erzeugt. Das grüne Ende des Magnetes (Bild links, 1) wird zum roten Pol des Statorts (Bild links, N) gezogen. Der Rotor wird also in Drehung versetzt. Funktionsweise des Polwenders: Halbringe, 2 Schleifkontakte Wenn der Rotor-Pol 1 beim roten Stator-Pol angelant ist, wird die Drehung gebremst, da die beiden Polen sich jetzt wieder voneinander entfernen müssen. Um dies zu verhindern, wechselt man sofort die Stromrichtung im Rotor. Dies hat zur Folge, dass jetzt zwei rote Polen zusammenkommen (Bild rechts, 1 und N). Diese stossen sich ab, und die Drehung geht weiter. Die Einrichtung, welche im richtigen Augenblick die Stromrichtung wechselt, heisst „Polwender und besteht aus zwei Halbringen und zwei Kohlestiften, welche als Schleifkontakte den Strom auf die Spule übertragen. Die beiden Anschlüsse der Rotorspule sind mit den Halbringen verbunden. Da die Halbringe auf Elektrizitätslehre Physik; NS Physik der Achse des Rotors sitzen, schleifen sie jeweils eine halbe Drehung über den Anschluss des positiven und dann wieder über jenen des negativen Pols der Spannungsquelle. Dadurch wird auch das Magnetfeld jede halbe Drehung umgepolt. Geschieht die im richtigen Moment, so dreht der Motor stetig. Die nachfolgenden Skizzen zeigen einzelne Phasen der Bewegung des Rotors im Magnetfeld des Stators. Beschreibe sie. a) b) c) d) Das Prinzip des Elektromotors theoretisch zu verstehen, ist alles andere als einfach. Aus diesem Grund beziehst du jetzt einen Elektromotor-Bausatz bei der Lehrperson. Studiere den Plan und die Anweisungen genau und erstelle deine eigenen Elektromotor. Beschrifte die Abbildung korrekt. Erkläre das Prinzip des Elektromotors nun in eigenen Worten: Der Transformator (ab S. 227) Das Wort Transformator kommt vom lateinischen Wort transformare, was soviel wie umwandeln heisst. Mit einem Transformator werden Spannungen erhöht oder verringert. Trafostationen gibt es in jeder Gemeinde mehrfach. Sie sorgen dafür, dass die Spannung des Stroms aus dem Kraftwerk von teilweise 40 kV auf die Netzspannung von 230 Volt verringert wird. Wie funktioniert ein Transformator? Zeichne auf und erkläre. Elektrizitätslehre Physik; NS Physik Welche Spannung ein Transformator erzeugt, wird durch die Windungszahl der Spulen bestimmt. Beispiele: Primärspule Sekundärspule 600 Windungen 200 Windungen 230 ?V Primärspule 600 Windungen 230 Sekundärspule 26 Windungen Primärspule 600 Windungen 320 Sekundärspule 60 Windungen Elektrizitätslehre Physik; NS