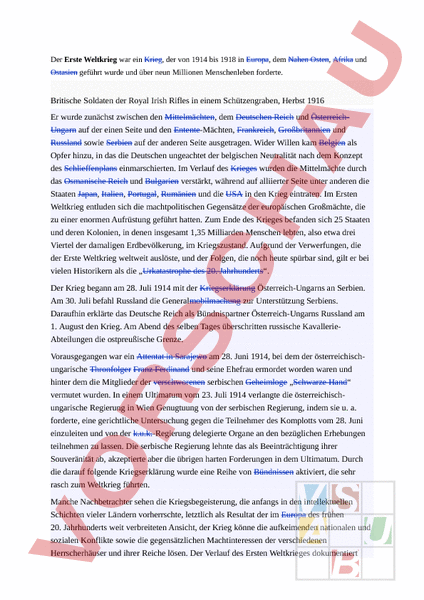Arbeitsblatt: 1.Weltkrieg
Material-Details
Zusammenfassung
Geschichte
Neuzeit
10. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
99922
1020
6
09.06.2012
Autor/in
Va ca
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Der Erste Weltkrieg war ein Krieg, der von 1914 bis 1918 in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Ostasien geführt wurde und über neun Millionen Menschenleben forderte. Britische Soldaten der Royal Irish Rifles in einem Schützengraben, Herbst 1916 Er wurde zunächst zwischen den Mittelmächten, dem Deutschen Reich und ÖsterreichUngarn auf der einen Seite und den Entente-Mächten, Frankreich, Großbritannien und Russland sowie Serbien auf der anderen Seite ausgetragen. Wider Willen kam Belgien als Opfer hinzu, in das die Deutschen ungeachtet der belgischen Neutralität nach dem Konzept des Schlieffenplans einmarschierten. Im Verlauf des Krieges wurden die Mittelmächte durch das Osmanische Reich und Bulgarien verstärkt, während auf alliierter Seite unter anderen die Staaten Japan, Italien, Portugal, Rumänien und die USA in den Krieg eintraten. Im Ersten Weltkrieg entluden sich die machtpolitischen Gegensätze der europäischen Großmächte, die zu einer enormen Aufrüstung geführt hatten. Zum Ende des Krieges befanden sich 25 Staaten und deren Kolonien, in denen insgesamt 1,35 Milliarden Menschen lebten, also etwa drei Viertel der damaligen Erdbevölkerung, im Kriegszustand. Aufgrund der Verwerfungen, die der Erste Weltkrieg weltweit auslöste, und der Folgen, die noch heute spürbar sind, gilt er bei vielen Historikern als die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Der Krieg begann am 28. Juli 1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Am 30. Juli befahl Russland die Generalmobilmachung zur Unterstützung Serbiens. Daraufhin erklärte das Deutsche Reich als Bündnispartner Österreich-Ungarns Russland am 1. August den Krieg. Am Abend des selben Tages überschritten russische KavallerieAbteilungen die ostpreußische Grenze. Vorausgegangen war ein Attentat in Sarajewo am 28. Juni 1914, bei dem der österreichischungarische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Ehefrau ermordet worden waren und hinter dem die Mitglieder der verschworenen serbischen Geheimloge „Schwarze Hand vermutet wurden. In einem Ultimatum vom 23. Juli 1914 verlangte die österreichischungarische Regierung in Wien Genugtuung von der serbischen Regierung, indem sie u. a. forderte, eine gerichtliche Untersuchung gegen die Teilnehmer des Komplotts vom 28. Juni einzuleiten und von der k.u.k.-Regierung delegierte Organe an den bezüglichen Erhebungen teilnehmen zu lassen. Die serbische Regierung lehnte das als Beeinträchtigung ihrer Souveränität ab, akzeptierte aber die übrigen harten Forderungen in dem Ultimatum. Durch die darauf folgende Kriegserklärung wurde eine Reihe von Bündnissen aktiviert, die sehr rasch zum Weltkrieg führten. Manche Nachbetrachter sehen die Kriegsbegeisterung, die anfangs in den intellektuellen Schichten vieler Ländern vorherrschte, letztlich als Resultat der im Europa des frühen 20. Jahrhunderts weit verbreiteten Ansicht, der Krieg könne die aufkeimenden nationalen und sozialen Konflikte sowie die gegensätzlichen Machtinteressen der verschiedenen Herrscherhäuser und ihrer Reiche lösen. Der Verlauf des Ersten Weltkrieges dokumentiert zudem die Unfähigkeit der europäischen Führungsschichten, militärische Neuerungen und soziale Spannungen entsprechend zu erkennen oder zu akzeptieren (vergleiche auch Kriegsschulddebatte). Der Erste Weltkrieg war der erste Krieg, der mit massivem Materialeinsatz (Panzer, Flugzeuge, Luftschiffe) und mit Massenvernichtungswaffen (Giftgas) geführt wurde. Die Fronten bewegten sich, vor allem im Westen, dennoch kaum, zum Teil, weil der modernen Technik die alten Militärstrategien gegenüber standen. Im endlosen Stellungskrieg rieben sich die Truppen gegenseitig auf. Insbesondere auf den Schlachtfeldern vor Verdun und in Flandern fielen auf beiden Seiten Hunderttausende von Soldaten, ohne dass sich etwas an der militärischen Lage änderte. Auch deswegen stellt sich der Erste Weltkrieg als ein Krieg dar, der an Grauen alles bis dahin Bekannte Politische Ausgangssituation Siehe auch: Zeitalter des Imperialismus Mittel- und Osteuropa An der Schwelle des 20. Jahrhunderts gab es in Mittel- und Osteuropa wesentlich weniger Staaten als heute. Das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Russland teilten sich das Gebiet im Wesentlichen untereinander auf. Im Südosten Europas lag das ebenfalls Großmachtspolitik treibende Osmanische Reich. Kleinere Staaten gab es nur auf dem Balkan, der in den Jahrzehnten zuvor wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen der dortigen Völker und dem Aneinandergrenzen der expansiven europäischen Mächte mit dem Osmanischen Reich in dieser Region ein ständiger Unruheherd gewesen war. Im Deutschen Reich, Russland und Österreich-Ungarn, die sämtlich monarchisch regiert wurden und nur mehr oder weniger machtlose Parlamente hatten, gab es zahlreiche ethnische Minderheiten, die zumeist nach nationaler Unabhängigkeit strebten. Im 19. Jahrhundert waren unter anderem in Ungarn und Polen entsprechende nationalistische Aufstände unterdrückt worden. Besonders im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn „brodelte es erheblich zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Zudem stand die österreichischungarische Monarchie im krassen Gegensatz zum russischen Zarenreich, das sich als Sprecher der slawischen Völker unter „Wiener Herrschaft sah und als Schutzmacht des (unabhängigen Königreichs Serbien auftrat. Das Verhältnis Österreich-Ungarns zu beiden Staaten war erst wenige Jahre zuvor, 1908, im Zuge der Bosnischen Annexionskrise erheblichen Belastungen ausgesetzt gewesen, die bereits damals leicht in einen Krieg hätten münden können. Ideologisch wurde dieser Nationalismus mit dem Panslawismus begründet. Aber auch die deutsche Bevölkerung im Deutschen Reich und in Cisleithanien versuchte, ihre Dominanz gegen die anderen national gesinnten Völker zu behaupten. Amerikanischer Kontinent Am Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Vereinigten Staaten von Amerika bereits die stärkste wirtschaftliche und militärische Macht auf dem amerikanischen Kontinent. Ein fester Grundpfeiler amerikanischer Außenpolitik bildete seit 1823 die Monroe-Doktrin, durch die jedwede politische Einmischung der Alten Welt in der Neuen Welt als unfreundlicher Akt gegen die Vereinigten Staaten aufgefasst werden konnte. Die Monroe-Doktrin wurde z. B. bemüht, nachdem sich Texas, ursprünglich mexikanisches Territorium, auf Betreiben nordamerikanischer Siedler von Mexiko losgerissen hatte und 1845 in die Vereinigten Staaten aufgenommen worden war. Im Verlauf des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges annektierten die Vereinigten Staaten über 40 des mexikanischen Territoriums. Die MonroeDoktrin wurde wiederum bemüht, als Napoleon III. 1863 das Kaiserreich Mexiko ausrief und Erzherzog Maximilian, ein Bruder des österreichischen Kaisers, 1864 mexikanischer Kaiser wurde. Unter Berufung auf die Monroe-Doktrin setzten die Vereinigten Staaten den Abzug der französischen Truppen aus Mexiko durch, da befürchtet wurde, ein starkes Kaiserreich Mexiko könnte möglicherweise die annektierten Gebiete zurückverlangen. Maximilian wurde 1867 hingerichtet. Da Deutschland mit Österreich verbündet war, gewannen dieser noch nicht lange zurückliegende historische Zwischenfall und die Sorge um die von Mexiko annektierten Gebiete in den Vereinigten Staaten erneut Aktualität. Die annektierten Gebiete der Südstaaten stellten nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs sofort wieder ein besonderes politisches Reizthema dar. Westeuropa Die westeuropäischen Staaten hatten weite Teile der Welt unter sich in Kolonien aufgeteilt (siehe Kolonialismus). Großbritannien, das über besonders viele Kolonien in Afrika und Asien verfügte, war die führende Seemacht, die sich seit Beginn des Jahrhunderts durch das reichsdeutsche Flottenbauprogramm herausgefordert fühlte. Letzteres führte aus Sicht einiger Historiker zum Anwachsen der Spannungen im letzten Vorkriegsjahrzehnt. Das europäische Bündnissystem zwischen 1900 und 1914 In Europa hatten sich zwei Blöcke herausgebildet. Auf der einen Seite die Mittelmächte: Deutsches Reich und Österreich-Ungarn (verbündet mit Italien, das sich aber zunächst aus dem Krieg heraushalten wollte, und dem Osmanischen Reich). Auf der anderen Seite stand der russisch-französische Zweiverband, der durch jeweilige Ententen mit Großbritannien zur Triple-Entente verbunden war. Alle drei Staaten waren in Konflikt mit dem Deutschen Reich geraten: In Frankreich verspürten die französischen Nationalisten noch immer Rachegelüste wegen ihrer Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71. Die Seemacht Großbritannien fühlte sich vom Aufbau einer deutschen Kriegsflotte herausgefordert. Die Beziehungen Russlands zum Deutschen Reich hatten sich seit dem Berliner Kongress verschlechtert, bei dem sich das Zarenreich um seine Gebietsansprüche aus dem zuvor gewonnenen Krieg am Balkan gegen das Osmanische Reich durch Bismarck geprellt fühlte. Der 1887 zwischen dem Deutschen Reich und Russland abgeschlossene Rückversicherungsvertrag wurde 1890 vom neuen Deutschen Kaiser Wilhelm II. nicht erneuert. Militärische Ausgangslage Die Lage in Europa 1914 Die Entente war bei Beginn des Krieges in einer besseren Ausgangslage als die Mittelmächte. Sie verfügte über mehr Soldaten (auch aus ihren Kolonien), größere Rohstoffreserven und hatte größere Reserven an Kriegsmaterial. Auch an Waffentypen, insbesondere schwerer Artillerie, mangelte es den westlichen Alliierten nicht. Aufgrund von mangelnder Organisation konnte die Entente ihre personelle und materielle Überlegenheit zu Beginn des Krieges jedoch nicht entfalten. Kriegsziele Siehe auch Hauptartikel: Kriegsziele im Ersten Weltkrieg Deutsches Reich Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges überwog im Deutschen Reich noch die Auffassung, der Krieg habe bloßen Verteidigungscharakter. Ausgelöst durch die raschen Erfolge der Armee im Westfeldzug, wurden bald zum Teil fantastische Annexionsprojekte formuliert.[1] Dabei trat das überwiegend kommerziell dominierte Vorkriegsziel, nämlich die koloniale Expansion des Deutschen Reiches in Übersee und Vorderasien, zugunsten einer allgemeinen Machterweiterung in Europa zurück, denn durch die Mittellage in Europa fühlte sich das Deutsche Reich bedroht. Durch Annexionen in Ost und West in zum Teil extremer Größenordnung wollte man die gefährdete Hegemonialstellung des Deutschen Reiches auf dem europäischen Festland für alle Zukunft sichern.[2] Kanzler Bethmann Hollweg hatte am 9. September 1914 in seinem „Septemberprogramm die Kriegsziele festgelegt. Deutschland wollte seine seit der Reichseinigung stark gewachsene Machtstellung sichern und seine Ansprüche auf eine Weltpolitik geltend machen. Kriegsziele waren im Einzelnen: Abtretung des Erzbeckens von Briey sowie die wirtschaftliche Abhängigkeit Frankreichs von Deutschland. 1. Militärisch-politische und wirtschaftliche Kontrolle Belgiens durch Annexion von Lüttich und Antwerpen sowie der flandrischen Küste. 2. 3. Luxemburg wird deutscher Bundesstaat. 4. Eine wirtschaftliche Einheit Mitteleuropas unter deutscher Führung. 5. Vergrößerung des Kolonialbesitzes in Afrika. 6. Holland sollte in ein engeres Verhältnis zum Deutschen Reich gebracht werden. [3] Nachdem in der Euphorie der ersten Kriegswochen viele, meist unrealistische Kriegsziele aufgestellt worden waren, verbot Bethmann Hollweg Ende 1914 aus Rücksicht auf das neutrale Ausland und die deutsche Arbeiterschaft die öffentliche Kriegszieldebatte. Diese Beschränkung wirkte allerdings nur in sehr geringem Maße und wurde auf Betreiben der 3. Obersten Heeresleitung, auch wegen der psychologischen Mobilisierung der kriegsmüden Bevölkerung, aufgehoben.[4] Das Herzstück der deutschen Kriegszielpolitik im Westen war stets Belgien. Seit dem Septemberprogramm rückte keiner der politisch Verantwortlichen von der Forderung nach Beherrschung Belgiens als Vasallenstaat neben möglichst großen direkten Annexionen ab.[5] Zweites zentrales Kriegsziel war die, mehr oder weniger direkte Beherrschung Polens, neben der Annexion eines, je nach Herkunft des Konzeptes, unterschiedlich breiten Grenzstreifens. Im Rahmen der Randstaatenpolitik Deutschlands – der Zurückdrängung Russlands und der Schaffung einer Zone von Pufferstaaten, von Finnland bis zur Ukraine – lag der Schwerpunkt deutschen Expansionsstrebens im Osten vor allem im Baltikum. Gebietserweiterungen in Kurland und Litauen wurden von Vertretern aller weltanschaulichen Richtungen in fast allen Fällen verlangt.[6] Das deutsche Kriegsziel „Mittelafrika wurde besonders hartnäckig verfolgt. Ein Vorschlag von Wilhelm Heinrich Solf, dem Staatssekretär des Reichskolonialamtes, der im August und September 1914 ein konkretes Mittelafrika-Projekt entwarf, war die Verteilung der afrikanischen Kolonien Frankreichs, Belgiens und Portugals, den Bethmann Hollweg schließlich in sein Septemberprogramm einschloss.[7] Die annexionistische Propaganda erfasste nicht alle Bevölkerungskreise, sondern hauptsächlich industrielle und intellektuelle Schichten. In der zweiten Hälfte des Krieges war die sozialdemokratische Parole eines Friedens ohne Annexionen, vor allem unter den Soldaten, sehr populär. Die Ostfront nach dem Friedensschluss von Brest-Litowsk Der Vorfrieden von Brest-Litowsk am 3. März 1918 mit Sowjetrussland sah vor, dass Polen, Litauen, Estland und Kurland aus Russland ausschieden und auch die Ukraine und Finnland unabhängig wurden.[8] Einen Höhepunkt der deutschen Kriegszielpläne, mit ausgedehnten Annexionsgebieten und Einflusssphären im Osten und Südosten, bildete das Jahr 1918, zwischen dem Frieden mit Sowjetrussland und der Niederlage der Mittelmächte. Während den Verhandlungen zu den Zusätzen des Brest-Litowsker Friedensvertrags vom Sommer 1918 versuchte insbesondere Ludendorff die Gebiete Livland, Estland, die Krim, das Gebiet der Kuban- und Donkosaken als Brücke zum Kaukasus, das Kaukasusgebiet selbst, das Gebiet der Wolgatataren, das Gebiet der Astrachan-Kosaken und ferner Turkmenien und Turkestan als deutsche Einflusssphäre zu sichern. Dies geschah mal gegen den Willen und mal mit Duldung der Reichsleitung.[9] Kaiser Wilhelm II. entwickelte den Plan, Russland nach Abtretung Polens, der Ostseeprovinzen und des Kaukasus in vier unabhängige Zarentümer, die Ukraine, den Südostbund, als antibolschewistisches Gebiet zwischen der Ukraine und dem Kaspischen Meer, in Zentralrussland und Sibirien zu teilen. Diese Form der Beherrschung ergäbe eine Brücke nach Zentralasien zur Bedrohung der englischen Stellung in Indien.[10] Die Zusatzverträge zum Brest-Litowsker Frieden vom 27. August 1918 stellten zwar einen neuen Höhepunkt der Demütigung Russlands dar, setzten aber gleichzeitig diesen, noch viel weitergehenden Annexionsplänen ein vorläufiges Ende.[11] Die russischen Randstaaten von Finnland bis Georgien waren zwar nicht direkt annektiert worden, befanden sich aber in enger wirtschaftlicher und militärischer Abhängigkeit vom Deutschen Reich. Die Frage, die damals in der deutschen Führung diskutiert wurde, war aber auch, ob sich ein deutsch beherrschtes Mitteleuropa in einem zukünftigen Krieg gegen die zwei größten Seemächte Großbritannien und die USA durchsetzen könnte. Schließlich besaßen die beiden Weltmächte praktisch den unbegrenzten Zugriff auf das globale wirtschaftliche Potential mit seinen Ressourcen. Als Antwort darauf entwickelten die deutschen Planer die Idee des deutschen Großraumes von der Biskaya bis zum Ural. Der östliche Großraum, wehrwirtschaftlich geschlossen und verteidigungsfähig, autark und blockadefest, als Gegengewicht zu den Seemächten, löste damit Mitteleuropa als zentrales deutsches Kriegsziel ab.[12] Deutschland hatte im Gegensatz zu den anderen Kriegsführenden Staaten kein natürliches Kriegsziel, was eine Suche nach Zielen künstlichen Charakters, nach sich zog. Das Fehlen greifbarer nationaler Ziele, führte zu einer Konzentration auf reine Machtexpansion.[13] Einen Krieg zu beginnen, einem fremden Staat Gebiete abzunehmen, war von jeher das unbezweifelte Recht eines souveränen Staates gewesen. Deutschland verpasste in dieser Selbstverständlichkeit bei der Formulierung der Kriegsziele und dem Einsatz aller zu Gebote stehenden politischen und militärischen Mittel, den sich damals in aller Welt anbahnenden Umschwung in Politik und öffentlicher Meinung.[14] Das angestrebte Imperium Germanicum scheiterte nicht nur an der deutschen Kontinuität des Irrtums (Fritz Fischer), sondern auch an den Mängeln der inneren Strukturen des Reiches, das zu keinerlei Selbstbeschränkung als Vormacht eines Kontinentaleuropas fähig war. Es scheiterte aber auch an den Erfordernissen der Zeit, mit ihrem Selbstbestimmungsrecht der Völker, das vom Reich im Grunde nicht wirklich akzeptiert wurde.[15] Das Deutsche Reich war aufgrund seiner militärischen Macht, seines wirtschaftlichen Potentials und seiner territorialen Größe ohnehin schon die stärkste europäische Großmacht. Daher musste jede in seinem Wesen angelegt imperialistische Expansion zwangsläufig mit dem Gleichgewicht der Kräfte in Europa kollidieren. Hätte sich Deutschland gegen die stärkst mögliche Koalition aufrechterhalten, wäre ihm laut Ludwig Dehio automatisch eine hegemoniale Funktion in Europa und der Welt zugefallen.[16] Österreich-Ungarn Österreich-Ungarn nahm für sich in Anspruch, um seine Interessen auf dem Balkan und um seine Existenz schlechthin zu kämpfen, die es insbesondere durch Russland bedroht sah. Österreich-Ungarn strebte nicht nur die Eingliederung Serbiens, sondern auch Montenegros und Rumäniens oder Russisch-Polens an. Entgegen den nationalistischen Tendenzen der damaligen Zeit, hielt Österreich-Ungarn an der universalen Idee vom Kaisertum und somit am Vielvölkerstaat fest. In den ersten Kriegswochen erlaubten sich die österreichischen Staatsmänner in ihren Vorstellungen genaue territoriale Ziele. Einige Wochen später verdrängte jedoch das Überlebensmotiv geplante Erwerbungen.[17] Wie bei keiner anderen Großmacht standen bei der Monarchie auch negative Kriegsziele im Vordergrund: die Behauptung des Trentino, des Küstenlandes mit Triest und Dalmatien sowie der albanischen Küste gegen Italien, die Abwehr der rumänischen Ansprüche auf Siebenbürgen und die Bukowina, die Zurückweisung der großserbischen und südslawischen Bestrebungen in Bosnien-Herzegowina, Dalmatien, Kroatien und Slawonien, die Verteidigung gegen die panslawistischen Pläne Russlands in Galizien und Böhmen und nicht zuletzt der Widerstand gegen die deutschen Hegemonialbestrebungen. Auch die herrschenden Kreise der Monarchie wollten erobern und mussten nicht von äußeren Kräften zur Eroberung animiert werden. Aber die Hauptbestrebungen der österreichischungarischen Monarchie bildeten die Aufrechterhaltung ihres Bestandes, das heißt ihre Integrität.[18] Das offizielle Kriegsziel Österreich-Ungarns war die Erhaltung der Integrität der Monarchie. Inoffiziell versuchte die Monarchie allerdings ihre Stellung als Großmacht durch Einflussnahme, beziehungsweise Annexionen in Serbien, Montenegro, Albanien, Rumänien, Polen und der Ukraine zu stärken.[19] Dennoch war in der Praxis, durch das prekäre Gleichgewicht des Habsburgerreiches, der Erwerb slawischer oder rumänischer Gebiete nicht oder nur in beschränktem Umfange möglich, ohne die Vorrangstellung der Deutschen und Ungarn im Staatsverband zu schwächen. Frankreich Frankreich wollte Revanche für die von den Franzosen als schmerzhaft empfundene Niederlage von 1871 nehmen und Elsass-Lothringen zurückerobern. Es wollte darüber hinaus die durch den Deutsch-Französischen Krieg eingeleitete Vormachtstellung des Deutschen Reiches auf dem europäischen Festland beseitigen. Das wichtigste Kriegsziel der Nation tauchte bereits in den ersten Kriegstagen auf: Die Rückgewinnung Elsass-Lothringens. Diese Forderung blieb vom Anfang bis zum Ende des Krieges ein unverrückbares Kriegsziel.[20] Als nach dem Sieg an der Marne beschlossen wurde, den Krieg bis zum Ende der Hegemonie des preußischen Militarismus fortzuführen, traten bald auch weitere Ziele an die Öffentlichkeit, vom Saarbecken über linksrheinische Gebiete bis hin zur Infragestellung der Reichseinheit (in manchen Kreisen) oder zumindest ihrer Schwächung im föderativen Sinne. Im Herbst 1915 zeichneten sich schließlich jene französischen Kriegsziele ab, die in den kommenden Jahren immer wieder, mit unterschiedlicher offizieller Unterstützung, kaum verändert auftauchten. Die Rückkehr von Elsass-Lothringen in den Grenzen von 1814 oder sogar 1790, also mit dem Saargebiet, die Zurückdrängung Deutschlands an den Rhein durch Annexion oder Neutralisation des Rheinlandes, sowie eine wirtschaftliche und militärische Angliederung Belgiens und Luxemburgs an Frankreich.[21] Die überseeischen Kriegsziele Frankreichs manifestierten sich durch die Konzentration auf die Westfront, hauptsächlich bei den Vereinbarungen mit den Alliierten über den Nahen und Mittleren Osten und Westafrika. Priorität für viele Kolonialisten hatte ein geschlossenes französisches Westafrika, inklusive der deutschen und britischen Enklaven. Auch im Orient war Großbritannien mehr Konkurrent als der eigentliche Kriegsgegner, das Osmanische Reich. Die günstige Kriegslage im Sommer 1916, insbesondere der als entscheidend bewertete Kriegseintritt Rumäniens, bewirkte Diskussionen und Untersuchungen in Bezug auf die Friedensbedingungen. Zuerst entwarf Generalstabschef Joffre im August 1916 einen Plan der wünschenswerten Friedensbedingungen – mit Annexion des saarländischen Kohlebeckens, der Bildung von drei oder vier linksrheinischen Staaten mit Brückenköpfen am rechten Rheinufer, sowie einer Verkleinerung Preußens, zugunsten der anderen deutschen Staaten. Dieser Plan wurde im Oktober 1916 überarbeitet und verschärft, wobei eine dreißigjährige Okkupation des Rheinlandes und eine Teilung Deutschlands in neun unabhängige Staaten vorgesehen waren.[22] Das Kriegszielprogramm der Regierung Briand vom November 1916 war deutlich moderater. Danach sollte der deutsche Nationalstaat bestehen bleiben, Frankreich zumindest die Grenze von 1790, also Elsass-Lothringen mit dem Saarland, erhalten. Einer mit großen Schwierigkeiten verbundenen Okkupation des Rheinlandes wird die Errichtung zweier neutraler, unabhängiger Pufferstaaten unter französischem Schutz vorgezogen. Belgien wird, im Gegensatz zum Plan des Generalstabs, in Unabhängigkeit belassen. Manchen Regierungsmitgliedern ging das Programm zu weit, andere wollten wiederum keinen Verzicht auf Annexionen im Rheinland. Ministerpräsident Briand stand aber dahinter, weshalb es im Januar 1917, in revidierter Form, zum offiziellen Regierungsprogramm wurde. Die revidierte Form bezog sich jedoch in erster Linie auf die Verwendung subtilerer Formulierungen. So wurde das zumindest beim Anspruch auf die 1790er-Grenze weggelassen oder die Bezeichnung Pufferstaaten durch Neutralität und provisorische Okkupation ersetzt.[23] Alles sonstige sollte inter-alliierten Verhandlungen vorbehalten bleiben, was Frankreich freie Hand sicherte. Jedenfalls waren alle der Meinung, ein System von Pufferstaaten würde spätere Annexionen erleichtern. Das spektakulärste Kapitel in der Geschichte der französischen Kriegsziele wurde ohne Wissen Großbritanniens geschrieben – die Mission des Kolonialministers Doumergue in Petrograd im Februar 1917. Das Angebot Doumergues an Russland zur freien Festsetzung seiner Westgrenze war der Versuch, einen Sonderfrieden mit dem Deutschen Reich zu verhindern. Russland sicherte seinerseits den Franzosen Unterstützung bei ihren Forderungen zu. Frankreich wurde Elsass-Lothringen im Umfang des früheren Herzogtums Lothringen mit dem Saarbecken zugestanden, die nicht annektierten linksrheinischen Gebiete sollen ein autonomes und neutrales Staatswesen unter französischem Schutz bilden, das besetzt bleibt, bis alle Friedensbedingungen erfüllt sind.[24] Wenige Wochen später wurde die Abmachung durch die erste russische Revolution allerdings hinfällig, und die französische Kriegszielpolitik geriet wegen der unsicheren Kriegslage in eine Krise. Unter dem neuen Ministerpräsident Ribot trat durch das drohende Ausscheiden Russlands die Frage der Kriegsziele natürlich in den Hintergrund – offiziell wurde nur mehr an Elsass-Lothringen festgehalten.[25] Ribot verkündete, die Stunde ist noch nicht gekommen, um über alle Friedensbedingungen zu diskutieren und wies jegliche Annexionsbestrebungen zurück. Gleichzeitig ließ er aber die Möglichkeit unabhängiger Rheinstaaten offen und predigte weiterhin die Niederwerfung des preußischen Militarismus. Frankreich ist mit seinen Absichten nicht in Versailles gescheitert, konnte es doch, trotz aller Konzessionen an seine Alliierten, einen guten Teil seiner Ziele durchsetzen. Zwar musste das Land auf offene Annexionen im Saar- und Rheinland verzichten, hatte jedoch durch die Besetzung dieser Gebiete alle Möglichkeiten, den Vertrag, wie 1923 bei der Ruhrbesetzung, nachzubessern.[26] Russland Russland konzentrierte seine internationalen Interessen, nach dem verlorenen Krieg gegen Japan, auf den Balkan, als dessen natürliche Schutzmacht es sich sah. Dabei kam es unweigerlich zu starken Spannungen mit Österreich-Ungarn. Das Selbstverständnis Russlands als Erbe der byzantinisch-orthodoxen Kultur und die traditionelle Feindschaft gegen das Osmanische Reich, kamen in den russischen Kriegszielen ebenfalls zum Ausdruck. Nach dem osmanischen Kriegseintritt erhoffte man sich auf russischer Seite den Gewinn Konstantinopels und der Meerengen zwischen der Ägäis und dem Schwarzen Meer. Die russischen Kriegsziele umfassten neben dem alten Ziel der Meerengen, aber auch Galizien und das ins russische Gebiet hineinragende Ostpreußen. Im weiteren Sinne spielte sicher auch die Idee des Panslawismus, einer Zusammenfassung aller Slawen in einem Kontinentalblock, eine Rolle. In der ersten Siegeszuversicht erstellte der russische Außenminister Sasonow am 14. September 1914 ein 13-Punkte-Programm, das in manchen Aspekten als Gegenpart zum Septemberprogramm Bethmann-Hollwegs anzusehen ist. Sasonow sah in erster Linie territoriale Abtretungen Deutschlands, angeblich auf der Basis des Nationalitätenprinzips, vor. Russland würde den Unterlauf des Njemen (Memelland) und den östlichen Teil Galiziens annektieren sowie dem Königreich Polen den Osten der Provinz Posen, (Ober-) Schlesien und Westgalizien angliedern. Weitere Bestimmungen waren die oft genannten Fixpunkte alliierter Kriegszielprogramme: Elsass-Lothringen, vielleicht das Rheinland und die Pfalz an Frankreich, ein Gebietszuwachs für Belgien bei Aachen, Schleswig-Holstein zurück an Dänemark und die Wiederherstellung Hannovers. Österreich würde eine Dreifache Monarchie bilden, bestehend aus den Königreichen Böhmen, Ungarn und Österreich (Alpenländer). Serbien erhielte Bosnien-Herzegowina, Dalmatien und Nordalbanien, Griechenland hingegen Südalbanien, Bulgarien einen Teil Mazedoniens, England, Frankreich und Japan die deutschen Kolonien.[27] Großbritannien Großbritannien wollte sich der wachsenden Wirtschaftskraft Deutschlands entledigen und die starke deutsche Flotte ausschalten, da es seine Machtstellung durch das seit der Reichseinigung aufstrebende Deutschland bedroht sah. Die deutsche Invasion Belgiens war der offizielle Grund für Großbritanniens Kriegseintritt – die Wiederherstellung Belgiens blieb in den ersten Kriegsjahren daher auch das einzige erklärte wichtige Kriegsziel.[28] Zum Ziel der Befreiung Belgiens trat aber schon früh die Formel der Zerschlagung des preußischen Militarismus, zur Wahrung des europäischen Gleichgewichts, das durch die deutsche Besetzung Belgiens und der Kanalküste bedroht schien. Direkte territoriale Ziele auf dem europäischen Kontinent hatte Großbritannien jedenfalls zu keiner Zeit, auch außerhalb Europas habe Großbritannien, laut Premier Asquith, schon jetzt gerade so viel Land wie we are able to hold.[29] Dennoch mussten etwaige Interessen gegenüber Frankreich, Russland und den anderen Verbündeten gewahrt bleiben, was im Klartext Erwerbungen von deutschen und türkischen Besitzungen in Afrika und Vorderasien bedeutete. Territoriale Belange wurden offiziell immer, wohl um peinliche Implikationen zu vermeiden, als sekundär angesehen. Nach dem Ausscheiden des zaristischen Verbündeten konnte der Krieg propagandistisch hervorragend als Kreuzzug der Demokratie gegen Tyrannei und Despotismus geführt werden. Aber Ende 1916 wollte die englische Öffentlichkeit schließlich konkret wissen, wofür ihre Soldaten kämpfen und sterben sollten, was die Formulierung der Kriegsziele dringend machte.[30] Am 20. März 1917 bezeichnete Lloyd George die Beseitigung der reaktionären Militärregierungen und die Etablierung von populären Regierungen, als Basis des internationalen Friedens, als wahre Kriegsziele. Gegen Ende des Jahres einigte sich das Kabinett auf erste provisorische Kriegsziele. Es unterstützte französische Bestrebungen auf Elsass-Lothringen, italienische Forderungen, entgegen dem Vertrag von London, nur auf Basis des Nationalitätenprinzips, sowie die Restauration Belgiens, Serbiens und Rumäniens. Später kamen, neben der Forderung nach Unabhängigkeit Polens und der Völker der Donaumonarchie, auch eigene Expansionswünsche, in Form von Forderungen nach Selbstbestimmung für die deutschen Kolonien und den schon okkupierten arabischen Teilen der Türkei, unter British rule zu Tage.[31] Das Sykes-Picot-Abkommen vom 3. Januar 1916 regelte die Interessenszonen Großbritanniens und Frankreichs im Nahen Osten. Großbritannien erhielt das südliche Mesopotamien, während Palästina internationalisiert werden sollte. Die deutschen Kolonien in Afrika und Übersee sollten keinesfalls zurückgegeben werden.[32] Der Wegfall Russlands aus der Kriegskoalition machte das britische Konzept des Mächtegleichgewichts einerseits einfacher, aber zugleich in anderer Hinsicht auch schwieriger. Der russische Druck auf den deutschen Osten fiel nun weg und ein System von neuen Staaten musste die Bindung deutscher Kräfte im Osten übernehmen. Da diese neuen Staaten nie die Macht des alten Russischen Reiches entwickeln konnten, wurde der zuvor erwogene Anschluss Österreichs an Deutschland von den Briten, als nicht mehr zweckdienlich, verworfen. Im Westen war die Situation anders, da umfangreiche Annexionswünsche Frankreichs im Rheinland, wenn auch in verdeckter Form, eine Hegemonie der Franzosen einzuleiten drohten, die England durch Milderung der Friedensbedingungen für Deutschland zu verhindern suchte. Italien Auch Italien betrieb eine expansionistische Politik, die unter anderem auf italienisch besiedelte Gebiete unter österreichisch-ungarischer Herrschaft zielte. Durch Zustimmung Russlands, auf italienisches Drängen nach Erwerbung slawischer Gebiete an der Adria, kam schließlich der Geheimvertrag von London am 26. April 1915 zustande, dem am 23. Mai 1915 die Kriegserklärung an Österreich-Ungarn und der Angriff u. a. am Isonzo folgte. Der Vertrag von London spiegelt die Kriegsziele Italiens genau und verlässlich wider, weil durch seine günstige Verhandlungsposition Italien fast alle seine Forderungen durchsetzen konnte. Italien sollte demnach erhalten: das Trentino, Südtirol bis zum Brenner, die Stadt und das Gebiet von Triest, die Grafschaft Görz und Gradisca, ganz Istrien, die istrischen und einige weitere kleinere Inseln, aber nicht Fiume. Ferner erhielt Italien große Teile der Provinz Dalmatien. Zuletzt erwarb es noch den strategisch bedeutsamen albanischen Hafen Valona mit umfangreichem Hinterland. Auch sollte, bei einer etwaigen Teilung der Türkei, eine noch festzusetzende Region an der Südküste Kleinasiens an Italien gehen.[33] Dass die Vereinbarung, insbesondere in Bezug auf Dalmatien im Vertrag von Versailles nicht zur Gänze verwirklicht wurde, lag vor allem am Widerstand der Serben. Vereinigte Staaten von Amerika Ihren Ursprung hatte die amerikanische Kriegszielpolitik bereits in der Neutralitätszeit. Nach dem Kriegseintritt der USA führte Präsident Woodrow Wilson seine Politik ohne Bruch fort. Genaue Vorstellungen über einen gerechten Frieden hatte er in der ersten Kriegszeit nicht, jedenfalls kam für ihn ein Friede nur bei Wiedergutmachung an Belgien und der Räumung Frankreichs in Frage. Ansonsten scheute Wilson, mehr noch als andere Politiker, vor Festlegungen in territorialen Fragen zurück.[34] Das Hauptziel Wilsons nach Kriegseintritt war die Beseitigung des deutschen Militarismus und die Demokratisierung Deutschlands. Wilsons Gesamtstrategie war anfangs ähnlich der britischen Politik zu Kriegsbeginn. Er wollte den Verbündeten gerade so viel Unterstützung zukommen lassen, wie nötig. Am Ende des Krieges plante er, über die bankrotten Ententeländer hinweg, seinen eigenen Friedensplan durchsetzen.[35] Höhepunkt der amerikanischen Kriegszielpolitik waren zweifellos die 14 Punkte Wilsons vom 8. Januar 1918. Es wird darin die völlige Wiederherstellung der belgischen Unabhängigkeit gefordert, weiters die Rückgabe Elsass-Lothringens, die Festsetzung italienischer Grenzen entlang den Nationalitätengrenzen sowie die weitere Existenz Österreich-Ungarns, dessen Nationen aber eine freie Entwicklung ermöglicht werden sollte. Der Türkei wird Selbständigkeit zugestanden, allerdings ohne Einschluss anderer Nationalitäten, die Meerengen sollten durch internationale Garantien offen gehalten werden. Gefordert wird auch die Errichtung eines unabhängigen polnischen Staates, der unbestreitbar polnisch besiedelte Territorien umfassen sollte, mit freiem Zugang zum Meer.[36] Im Laufe des letzten Kriegsjahres wurde die Haltung Wilsons, vor allem durch den DiktatFrieden von Brest-Litowsk, gegenüber den Mittelmächten härter. Im Oktober 1918 ergänzten und erweiterten die Amerikaner Wilsons 14 Punkte. Die Punkte Belgien und ElsassLothringen wurden bestätigt, Italien wurde aus strategischen Gründen Südtirol zugebilligt, dessen kulturelles Leben aber autonom bleiben soll, sowie das Protektorat über Albanien. Hingegen seien Triest und Fiume, für das Gedeihen Böhmens, Deutschösterreichs und Ungarns, in Freihäfen umzuwandeln. Die 14 Punkte und ihre späteren Ergänzungen, waren nicht nur gegen die Mittelmächte, sondern ebenso gegen den Imperialismus der Alliierten gerichtet.[37] Die Bestimmungen über Österreich-Ungarn könnten nicht mehr aufrechterhalten werden. Daher erklärte die Regierung, für die Befreiung aller slawischen Völker unter der deutschen und österreichisch-ungarischen Herrschaft eintreten zu wollen. Am 18. Oktober teilte Wilson dem Habsburgerstaat mit, die Nationalitäten müssten ihre Zukunft selbst bestimmen. Ostgalizien gehöre, da ukrainisch, nicht wie Westgalizien zu Polen, Deutschösterreich sollte von Rechts wegen erlaubt sein, sich an Deutschland anzuschließen. Serbien sollte als Jugoslawien mit einem Zugang zur Adria in Erscheinung treten. Rumänien sollte die Dobrudscha, Bessarabien und Siebenbürgen erwerben, Bulgarien sollte seine Grenze in der Süddobrudscha, wie vor dem Zweiten Balkankrieg haben, es sollte auch Teile von Thrazien besitzen. Mazedonien sollte aufgeteilt werden. Der neue polnische Staat, dessen Zugang zum Meer westlich der Weichsel noch nicht festgelegt wurde, sollte keine Gebiete im Osten bekommen, die von Litauern und Ukrainern besiedelt sind, den deutschen Bewohnern Posens und Oberschlesiens sei ein Schutz zu gewähren. Armenien war nach diesem Plan ein (Frei-) Hafen am Mittelmeer zuzuteilen und es sollte unter britischen Schutz kommen. Schließlich wurde auch noch die Teilung des Nahen Ostens zwischen Großbritannien und Frankreich anerkannt.[38] Im Vergleich zu Großbritannien machten die USA Frankreich bei der Friedenskonferenz weit weniger Schwierigkeiten bei der Verwirklichung ihrer Kriegsziele als erwartet. In Europa hatten sich zwei Blöcke herausgebildet. Auf der einen Seite die Mittelmächte: Deutsches Reich und Österreich-Ungarn (verbündet mit Italien, das sich aber zunächst aus dem Krieg heraushalten wollte, und dem Osmanischen Reich). Auf der anderen Seite stand der russisch-französische Zweiverband, der durch jeweilige Ententen mit Großbritannien zur Triple-Entente verbunden war. Alle drei Staaten waren in Konflikt mit dem Deutschen Reich geraten: In Frankreich verspürten die französischen Nationalisten noch immer Rachegelüste wegen ihrer Niederlage im DeutschFranzösischen Krieg von 1870/71. Die Seemacht Großbritannien fühlte sich vom Aufbau einer deutschen Kriegsflotte herausgefordert. Die Beziehungen Russlands zum Deutschen Reich hatten sich seit dem Berliner Kongress verschlechtert, bei dem sich das Zarenreich um seine Gebietsansprüche aus dem zuvor gewonnenen Krieg am Balkan gegen das Osmanische Reich durch Bismarck geprellt fühlte. Der 1887 zwischen dem Deutschen Reich und Russland abgeschlossene Rückversicherungsvertrag wurde 1890 vom neuen Deutschen Kaiser Wilhelm II. nicht erneuert.