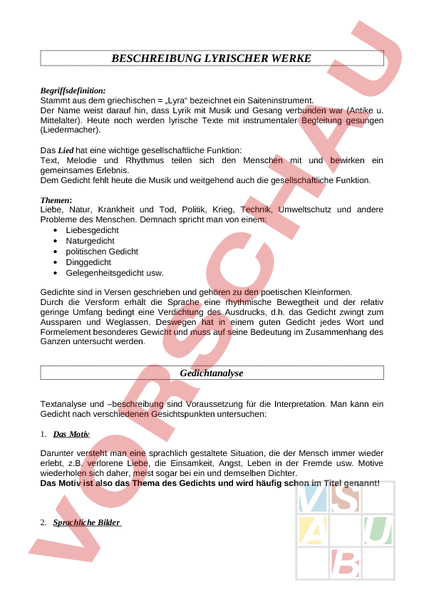Arbeitsblatt: Beschreibung lyrischer Werke
Material-Details
Theorie
Deutsch
Textverständnis
8. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
62933
828
6
19.06.2010
Autor/in
Manuela Röd
Land: andere Länder
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
BESCHREIBUNG LYRISCHER WERKE Begriffsdefinition: Stammt aus dem griechischen „Lyra bezeichnet ein Saiteninstrument. Der Name weist darauf hin, dass Lyrik mit Musik und Gesang verbunden war (Antike u. Mittelalter). Heute noch werden lyrische Texte mit instrumentaler Begleitung gesungen (Liedermacher). Das Lied hat eine wichtige gesellschaftliche Funktion: Text, Melodie und Rhythmus teilen sich den Menschen mit und bewirken ein gemeinsames Erlebnis. Dem Gedicht fehlt heute die Musik und weitgehend auch die gesellschaftliche Funktion. Themen: Liebe, Natur, Krankheit und Tod, Politik, Krieg, Technik, Umweltschutz und andere Probleme des Menschen. Demnach spricht man von einem: • Liebesgedicht • Naturgedicht • politischen Gedicht • Dinggedicht • Gelegenheitsgedicht usw. Gedichte sind in Versen geschrieben und gehören zu den poetischen Kleinformen. Durch die Versform erhält die Sprache eine rhythmische Bewegtheit und der relativ geringe Umfang bedingt eine Verdichtung des Ausdrucks, d.h. das Gedicht zwingt zum Aussparen und Weglassen. Deswegen hat in einem guten Gedicht jedes Wort und Formelement besonderes Gewicht und muss auf seine Bedeutung im Zusammenhang des Ganzen untersucht werden. Gedichtanalyse Textanalyse und –beschreibung sind Voraussetzung für die Interpretation. Man kann ein Gedicht nach verschiedenen Gesichtspunkten untersuchen: 1. Das Motiv Darunter versteht man eine sprachlich gestaltete Situation, die der Mensch immer wieder erlebt, z.B. verlorene Liebe, die Einsamkeit, Angst, Leben in der Fremde usw. Motive wiederholen sich daher, meist sogar bei ein und demselben Dichter. Das Motiv ist also das Thema des Gedichts und wird häufig schon im Titel genannt! 2. Sprachliche Bilder Das lyrische Motiv wird meist in Bildern dargestellt. Die Bildlichkeit ist also ein wesentliches Kennzeichen dichterischer Sprache. Besondere Formen des sprachlichen Bildes sind: • Der Vergleich Aber wie siehst du denn aus? Nüchtern und blaugrün wie eine leere Weinflasche. Beim Vergleich werden zwei Bildbereiche aufgebaut, ein Grundbereich und ein Vergleichsbereich. Beide haben etwas gemeinsam: das Aussehen des Freundes wie eine leere Flasche nüchtern und blaugrün Grundbereich Vergleichspartikel Vergleichsbereich gemeinsames Drittes Vergleiche sind leicht an den Vergleichspartikeln zu erkennen: als, wie, als wie, als ob, gleich wie • Die Metapher Eine Metapher liegt dann vor, wenn ein Wort aus dem Bereich seiner üblichen Bedeutungsbeziehung herausgenommen und in eine neue Bedeutungsbeziehung gestellt wird. „Begraben kann man eigentlich nur Menschen oder Tiere. Und dennoch kann man sagen: Er hat all seine Hoffnungen begraben. • Die Personifikation Sie ist eine Sonderform der Metapher. Einem Begriff, der Abstraktes oder NichtLebendiges meint, werden Eigenschaften und Handlungsweisen zugeordnet, die eigentlich nur Lebewesen zukommen: Gelassen steigt die Nacht ans Land. • Die Allegorie Ist eine vollständige Personifikation: Ein abstrakter Begriff wird als Gestalt, meist als Person dargestellt. Die „Frau Minne 3. Symbole Bilder werden in lyrischer Sprache häufig zu Sinnbildern Stets handelt es sich um ein Ding, das auf etwas anderes Abstraktes verweist. Das sprachliche Symbol ist zunächst ein Bild, das in sich geschlossen ist und für sich spricht, z.B. der Ring als Schmuckstück. Darüber hinaus ist es Sinnbild, es verweist auf eine zweite Sinnebene Vertrautheit, Verbundenheit. Das Symbol hat also eine doppelte Bedeutung! 4. Weitere Stilfiguren (siehe Anhang) 5. Die Sprache Sie stellt Augenblicke, Stimmungen, Situationen und Gedanken dar. Das Verb steht häufig im Präsens oder fehlt ganz. Lyrische Sprache ist weitgehend offen, d.h. ein Begriff kann mehrere Vorstellungen ermöglichen. So bedeutet in einem Gedicht das Wort „Krähe nicht nur eine zoologisch definierbare Art von Vögeln, sondern auch Spätherbst, Winter, Kälte, Schnee, Vereinsamung, Angst. Ein gutes Gedicht ist daran zu erkennen, dass es mit wenigen Worten viel ausdrückt! 6. Die Form Die Zeile in einem Gedicht nennt man Vers ( gesprochene rhythmische Einheit), er besteht aus einer annähernd regelmäßigen Abfolge stärker und schwächer betonter Silben. Die Sprache erhält dadurch harmonische Bewegung. Dieser Bewegung liegt ein Metrum (Versmaß) zugrunde. Die wichtigsten Taktarten sind: • • • • Jambus Trochäus Anapäst Daktylus xx xx xxx xx Für den Rhythmus ist das Ende des Verses von Bedeutung. Der Vers kann mit einer • Unbetonten Silbe schließen klingend weiblicher Vers oder mit einer • Betonten Silbe stumpf männlicher Vers. Diesen Abschluss einer Zeile bezeichnet man als Kadenz. Die Verse eines Gedichtes können aus relativ geschlossenen grammatischen und inhaltlichen Einheiten bestehen Zeilenstil, d.h. das Satzende ist zugleich auch das Versende. Häufig greift die Satz- bzw. Sinneinheit von einer Verszeile auf die andere über Verssprung oder Enjambement. Dies wird dann eingesetzt, wenn das Versmaß überspielt werden soll. Mit einem Dach und seinen Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von bunten Pferden (.) Wenn die meisten oder alle Verszeilen einer Strophe mit einem Verssprung enden, so spricht man vom Hakenstil. Besonderheiten: Der Satzbau weicht in Gedichten oft von der Norm ab. Durch auffällige Wiederholungen und ungewöhnliche Satzstellungen entstehen zusätzliche Strukturen im Gedicht, welche den Text nicht nur gliedern, sondern auch die Bedeutung unterstreichen und erweitern. Solche Abweichungen erschweren manchmal auch das Textverständnis. • Inversion: Normaler Bauplan eines Aussagesatzes: Subjekt – Prädikat – Ergänzungen. Werden andere Satzglieder als das Subjekt in das Vorfeld gerückt, ziehen sie die Aufmerksamkeit auf sich. Subjekt an letzter Stelle Gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die Abendglocke. Nachgestellte Adjektive zu tausend Wüsten stumm und kalt, statt: zu tausend stummen und kalten Wüsten. Vorangestellte Genitivattribute deines Wipfelmeers gewaltig Rauschen, statt: das gewaltige Rauschen deines Wipfelmeers. Zusammengehörende Wörter, die durch andere Satzteile getrennt werden Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern, statt: Da macht mich ein Hauch von Zerfall erzittern. • Ellipse: Manche Wörter sind zwar zur Bildung eines grammatisch vollständigen Satzes notwendig, doch für das Verständnis entbehrlich. Das Weglassen solcher Wörter, die leicht aus dem Sinnzusammenhang erschlossen werden können, bezeichnet man als Ellipse. • Prolepse: In manchen Gedichten wird der Satz nach einem Nomen abgebrochen und anschließend mit dem passenden Pronomen wieder aufgenommen und zu Ende geführt. Und die Wellen, sie zerschellen statt: und die Wellen zerschellen. Solche Satzunterbrechungen können drei Gründe haben: Hervorhebung des einleitenden Satzgliedes, Einhaltung des Metrums, Verständnis in unübersichtlichen Sätzen. • Wiederholung und Variation: Eignen sich besonders dazu, die innere Gliederung von Gedichten zu verdeutlichen. Aber sie schaffen auch Einheitlichkeit und tragen so dazu bei, dass Gedichte als harmonisch, geordnet und abgerundet empfunden werden. In der modernen Lyrik sind sie besonders wichtig, um freien Versen ohne Reim und Metrum einen poetischen Charakter zu geben und sie von der alltäglichen Prosa abzusetzen. (Anapher, Epipher, Klimax, Parallelismus, Chiasmus) 7. Der Klang Gedichte können durch die Anordnung der Laute besondere hervorbringen. Die bekannteste Anordnung ist der Endreim. Reimfolgen: • • • • • Paarreim Kreuzreim abab Verschränkter Reim Schweifreim Durchgehender Reim Klangwirkungen aabb abba aabccb aaaa Binnenreim: Gleichklang des Versendes mit einem Wort im Versinneren Dass keine Hand die andre fand (.) Schlagreim: unmittelbares Aufeinanderfolgen von Reimwörtern Quellende, schwellende Nacht (.) Alliteration: zwei oder mehrere Wörter innerhalb des Verses beginnen mit demselben betonten Anlaut Lieb und Leid im leichten Leben (.) Assonanz: Gleichklang der Vokale ab der letzten betonten Silbe, wobei die Konsonanten unterschiedlich sind. Schweifen/leise Refrain: regelmäßige Wiederholung eines oder mehrerer Verse, evtl. auch einzelner Wörter. Lautmalerei: kann den sinnlichen Eindruck verstärken. Man versteht darunter die sprachliche Nachahmung natürlicher Geräusche und Laute. Kuckuck, klatschen, summen Häufung gleicher Vokale: kann den Klangcharakter von Versen bestimmen. Man Unterscheidet dabei dunkle und dumpfe Vokale (a – – ö – – au) und helle Vokale (e – – ü).